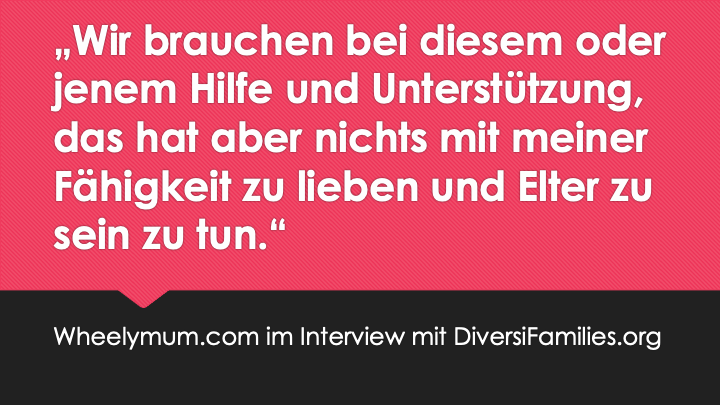Eine ganz normale Familie
Das Interview führte Conni von DiversiFamilies und liebevoll autistisch.
Ich spreche heute mit Ju, die den wunderbaren Familien- und Inklusions-Blog wheelymum betreibt.
Wir haben uns kennengelernt bei einem Online-Seminar zum Thema selbstbestimmte Familienplanung für inter, trans und behinderte Menschen mit Tristan Marie Biallas, Natalie Dedreux und Anne Leichtfuß beim Familia*Futura Festival.
Ich war sehr, sehr froh, dass Du auch da warst, Ju. Ohne Dich wäre ich mir ziemlich verloren vorgekommen, als eine Person, die eine Behinderung hat und Elter ist.
Ich erlebe das immer wieder, wenn über ähnliche Themen gesprochen wird: Dann sind wohlmeinende Eltern von Kindern mit Behinderungen da, Sozialarbeiter*innen und teilweise Menschen mit Behinderung, die sehr gut Bescheid wissen um die Beschränkungen ihrer Selbstbestimmung und ihrer reproduktiven Rechte aber die tatsächlich noch nicht den Schritt zur Elternschaft gegangen sind oder sich nicht als Eltern positionieren. Deswegen war das für mich sehr wichtig, dass Du da warst und was Du gesagt hast und deswegen wäre meine erste Frage an Dich auch:
Wieviel Mut braucht es heutzutage noch um sich als Eltern mit Behinderung zu positionieren?
Ja, genau das war der Grund aus dem ich den Blog wheelymum gestartet habe. Weil ich dachte, ich kann doch nicht die einzige Mama im Rollstuhl sein. Mir hat der Austausch gefehlt und ich bin immer noch auf der Suche nach Gleichgesinnten und diesem Mut, sich zu zeigen.
Ich merke das, wenn ich Fragen per Email bekomme, die ich selbst nicht beantworten kann oder möchte, weil es sich zum Beispiel um eine andere Behinderung handelt oder ein anderes Umfeld. Dann schlage ich manchmal vor: „Sollen wir die Frage in die Community raushauen, auch gerne anonym?“. Dann kommt oft die Antwort: „Nee, lieber doch nicht.“
Diese Hemmschwelle ist leider immer noch da, die viele daran hindert offen zu sagen: „Ich bin Elter, ich habe eine Behinderung und wir stemmen das trotzdem.“ oder: „Wir brauchen bei diesem oder jenem Hilfe und Unterstützung, das hat aber nichts mit meiner Fähigkeit zu lieben und Elter zu sein zu tun.“
Du hast bei unseren Treffen neulich gesagt Dein Blog sei eine Mischung aus Familien- und Inklusionsblog. Was bedeutet für Dich „Familie“, was bedeutet für Dich „Inklusion“ und wie hängt das beides zusammen für Dich?
Familie bedeutet für mich tatsächlich unheimlich viel. Familie kann so vielfältig sein. Ich finde wir müssen hier endlich raus aus diesen Rastern und Schubladen. Familie ist da, wo man sich gegenseitig liebt und unterstützt.
Inklusion ist alles das was dazu befähigt, dass alle Menschen teilhaben können. Das ist vielfältig und ich lerne hier immer dazu. Auch ich habe keine Vorstellung davon, wie es für jemanden mit einer anderen Behinderung als meiner ist. Ich weiß, dass mich die Bordsteinkanten stören, weil ich da mit dem Rollstuhl nicht hochkomme. Ich weiß aber mittlerweile auch, dass irgendeine Markierung für blinde Menschen wichtig ist.
Man denkt oft ein bisschen in seiner eigenen Blase. Das was man kennt das kennt man und darüber kann man sich beschweren. Mir ist aber diese Offenheit wichtig, zu gucken: wie ist es bei anderen? Dabei spreche ich nicht für diese, sondern nehme einfach nur wahr, dass es da noch etwas über dem Tellerrand gibt.
Genau diese bunte Mischung zeigt sich auch auf dem Blog. Denn in vielen Dingen sind wir eine ganz einfache, „normale“ Familie. Hier wird gestritten, hier wird gelacht, hier gibt es Probleme mit der Schule, hier gibt es Wutanfälle bei Dreijährigen und die probiere ich genauso zu begleiten wie Du oder jede*r andere Mama oder Papa auch. Genau dafür steht wheelymum.
Ich bin nicht ein Aktivist wie Raul Krauthausen, der eine Parole nach der anderen raushaut. Das ist sein Job, ich finde das sehr gut und superwichtig was er macht. Aber mir geht es um die Mischung und darum zu zeigen wie ein Familienleben mit einer Mama mit Behinderung aussehen kann. Es ist unser Leben und es sind unsere Themen, es ist nicht auf andere übertragbar.
Magst Du mir mehr über Deine Familie erzählen? Wer gehört dazu und was magst Du besonders an Deiner Familie?
Es gibt meinen Mann und mich und zwei Söhne. Der große Sohn wird jetzt im Juli acht und der kleine wurde im Januar drei. Das ist das ganz normale Leben mit der einen oder anderen Besonderheit und auch mit den einen oder anderen Steinen, die man uns in den Weg legt. Darauf kann ich in meinem Blog aufmerksam machen und damit möchte ich anderen auch Mut machen: Ihr seid damit nicht allein, lasst Euch davon nicht abschrecken! Es gibt immer eine Lösung und es kostet Kraft und ich finde es wirklich ein Unding, dass wenn man schon eine Behinderung hat, man um fast alles kämpfen muss. Aber es geht und es sollte kein Grund sein zu sagen: Deswegen kann ich keine Familie haben oder keine Kinder haben.
Steine, die einem in den Weg gelegt werden: Barrieren und Vorurteile
Die Steine im Weg sind ja auch der Grund, warum es Mut erfordert über ein „normales“ Familienleben zu sprechen, das aber von vielen nicht so empfunden wird. Wer legt Dir die Steine in den Weg, sind es Ärzt*innen, sind es Behörden, ist es im Alltag?
Es ist alles, was Du gerade angesprochen hast. Es erfordert viel Aufklärungsarbeit. Bei meinem ersten Kind hat es mit dem Arzt angefangen. Ich war schwanger. Meine Gynäkologin hat gesagt sie freut sich mit mir, sie begleitet das gerne, aber sie wollte, dass ich von einer Uniklinik mitbetreut werde. Das hat sich als sehr sinnvoll erwiesen, und ihre Offenheit hat es leichter gemacht. Sie hat mich nicht abgegeben, sondern sie hat mich zeitgleich betreut.
Allerdings ging ich dann zum Neurologen, der eigentlich mein Hauptarzt für meine Krankheit war und der war völlig schockiert und hat mir sofort einen Abbruch nahegelegt, weil: „solche Eltern wie mich gibt’s ja eigentlich nicht“. Er hat das nicht direkt gesagt, aber es ist mitgeschwungen und: „solche Eltern sollte es auch nicht geben. Weil man sich da ja nicht richtig um die Kinder kümmern kann.“ Ich war damals so perplex, ich habe leider nicht so viel darauf gesagt. Mittlerweile wäre das vielleicht anders. Aber in dem Moment war ich völlig vor den Kopf gestoßen. Ich habe ihm danach einen Brief geschrieben mit dem Inhalt, dass ich das Arzt-Patient-Verhältnis beende, weil keine Vertrauensbasis mehr da ist.
Ich habe mir selbst auch Gedanken und Sorgen gemacht, wie viele werdende Eltern das tun. Wie kann ich mein Kind versorgen? Was für Hilfsmittel brauche ich dafür? Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch einen Aktiv-Rollstuhl, den man selbst schieben muss. Überall wo ich mich informiert habe bekam ich die Antwort, dass ein Rollstuhl mit elektrischem Antrieb wichtig wäre. Und niemand fühlte sich zuständig. Eine Mitarbeiterin der Krankenkasse hat zu mir gesagt: „Nein, wir sind nicht für die Versorgung des Kindes zuständig. Kinder sind Ihr Privatvergnügen. Sie konnten es alleine machen, dann müssen Sie es auch alleine versorgen können.“ Das Jugendamt hat gesagt: „Wenn Sie einen Rollstuhl brauchen, dann brauchen Sie den Rollstuhl und nicht das Kind. Das Kind sitzt ja nicht im Rollstuhl.“ In solche Zwickmühlen kam man da immer wieder. Da wurde brutalst Ableismus deutlich. Auch das Sanitätshaus habe ich gewechselt und kam dann zu jemandem, der sagte: „Wir suchen Lösungen““ und nicht „Wir suchen noch mehr Probleme.“ Erst als es mir in der Schwangerschaft schlechter ging, so dass ich mich selbst nicht mehr mit dem Aktiv-Rollstuhl fortbewegen konnte, konnte ich dann einen Elektro-Rollstuhl beantragen. Wäre das nicht gewesen weiß ich nicht was ich hätte machen müssen, damit die Versorgung steht.
Beide meiner Kinder wurden aus unterschiedlichen Gründen zu früh geboren und mussten auf die Frühchen-Intensivstation. Dort konnte ich mit dem Rollstuhl noch hin. Danach kamen sie auf eine Säuglings-Überwachungsstation. Da darf eigentlich ein Elternteil mit dabei sein. Ich durfte das aber nicht. Weil ich mich nicht selbst vom Bett in den Rollstuhl mobilisieren kann und das Kind nicht allein aus dem Brutkasten herausholen konnte. Ich hätte dazu Hilfe gebraucht und bekam zu hören: „Das geht nicht. Für Eltern wie Sie sind wir nicht ausgestattet.“ Strukturelle Barrieren: Da wurde einfach gar nicht an Eltern mit Behinderung gedacht. Bei meinem ersten Kind sind wir innerhalb des Krankenhauses von einem Altbau in einen Neubau umgezogen und für den Elektro-Rollstuhl waren da die Türen zu klein.
Das heißt bauliche Barrieren sind immer noch ein Riesenthema, auch im Gesundheitssystem?
Genau. Hier war es die Tür zum Bad. Die Haupt-Tür war groß genug, denn da mussten ja auch die Betten durchgeschoben werden, aber ich bin nicht ins Bad gekommen. Das war nur für die Krankenhausrollstühle ausgelegt, aber nicht dafür, dass Menschen mit ihrem eigenen Rollstuhl kommen. In einem Neubau vom Jahr 2013.
Aber natürlich gibt es dieses behindert werden auch im Alltag. Ich konnte in keine Mutter-Kind-Gruppe, weil es räumlich nicht ging. Spielplatz-Wahl ist bei uns schwierig, ich muss das genau auschecken: komme ich da mit dem Rollstuhl zurecht? Denn auf einen Spielplatz voller Sand kann ich nicht, da bleibe ich stecken. Bei uns auf dem Dorf gibt es Spielplätze, die sind auf einem Wiesenstück ohne Abgrenzung. Das konnte ich mit einem meiner Kinder auch nicht machen, weil das Vertrauen, dass er mir nicht wegrennt, nicht ganz gegeben war. Also checken wir das ziemlich genau aus.
Überhaupt ist das ein Großteil meiner Elternschaft: Dinge vorher zu probieren, abzuklären, zu regeln oder nachzufragen, damit ich die Situation einschätzen kann und keine große Angst habe: schaffe ich das? Wenn ich dann diese Ruhe habe, geht vieles leichter.
Einmal war ich mit meinem dreijährigen Sohn auf dem Spielplatz. Es gab da einen Hügel und dahinter ein kleines Wäldchen. Es war abgesprochen: Er darf da rein. Ich kann da zwar nicht reinfahren, aber wenn er Hilfe braucht, ruft er mich. Normalerweise reicht es, wenn ich reingucke und ihn mit Worten rauslotse. Ansonsten bitte ich jemanden, zu ihm zu gehen. Wir waren also auf dem Spielplatz und mein Sohn war in dem Wäldchen. Auf einmal kommt eine Mutter mit meinem schreienden Kind an. Ich habe gedacht: was ist passiert? Und sie trägt es so her und sagt: „Hier ist Deine Mama!“ (schroffer Tonfall, fast brüllend) Ich sag: „Was ist denn passiert?“ – denn ich hab ihn nicht rufen gehört – und er sagt: „Die Frau sagt, ich darf da nicht hin!“ Sag ich zu ihr: „Warum? Das war abgesprochen, das gehört zum Spielplatz, ich habe es ihm erlaubt.“ Sie sagt: „Ja, aber der muss in Ihrer Nähe bleiben.“ Nein. Ich bin die Mutter, ich habe das zu entscheiden und wenn wir zwei damit klar sind, dann geht das. Es war gut gemeint, aber völlig übergriffig. Und meine Erklärung kam bei ihr nicht an. Solche Sachen gibt’s leider immer noch und sie begleiten uns im Alltag.
Morgen könnt Ihr darüber lesen, was Behördenmitarbeiter*innen noch lernen können und was Erwachsene mit und ohne Behinderung von Kindern lernen können.