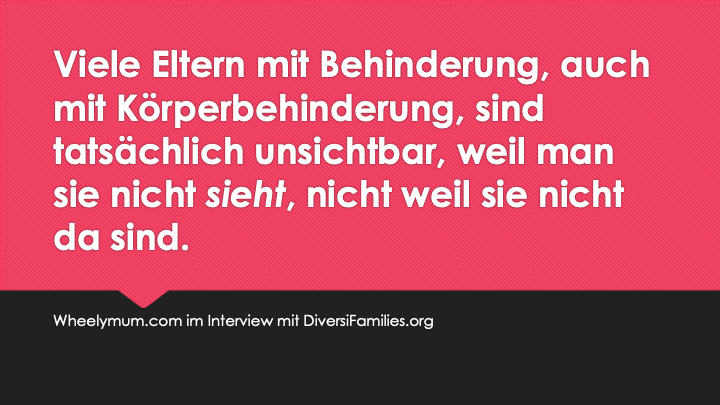Aktivismus mit abgezählten Löffeln
Das bringt mich zurück zu einem Deiner Eingangs-Statements. Du hast gesagt, Du bist keine Aktivistin wie Raul Krauthausen, aber Du bist ja doch Aktivistin, ne? Ich nehme Dich sehr stark als Aktivistin wahr mit Deinem Blog und mit der Art wie Du für Deine Rechte einstehst und andere dazu ermutigst und ich glaube Du bist auch über den Blog hinaus politisch aktiv. Möchtest Du noch etwas dazu sagen, wie Dein Aktivismus aussieht?
Ich möchte genau auf solche Dinge aufmerksam machen. Ich erzähle viel von uns. Ich tue mir schwer damit, für andere Menschen mit anderen Behinderungen zu sprechen.
Bei allem was ich mache: ich lebe mit meiner Behinderung. Ja, ich werde auch behindert von außen. Aber dennoch habe ich einfach nicht genug Löffel, falls Ihr die Spoony-Theorie kennt. Meine Kraft reicht einfach nicht für alles. Ich bin nicht schon immer behindert, ich weiß wie das früher war. Ich muss meine Zeit und meine Kraft einteilen und im Moment sind meine Kinder noch so klein, dass die mich stark brauchen.
Und so ganz aktivistisch bin ich dann eben nicht unterwegs, aber das ist auch nicht mein einziges Ziel. Ich will nicht nur sagen: das und das läuft in der Behindertenpolitik oder in der Familienpolitik für Menschen mit Behinderungen falsch. Ich will auch zeigen was gut läuft und eben auch dieses Bild von einer normalen – was auch immer normal ist – Familie im Alltag. Das ist mir sehr wichtig.
Wenn mir solche Sachen passieren, oder wenn an mich herangetragen wird: hier wurden wir behindert, da möchte ich auch mithelfen Öffentlichkeit zu schaffen. Was mir auch superwichtig ist, ist diese Vernetzung. Ich kenne andere Aktivisten mit Behinderung gut, aber ich bin auch mit ganz vielen Elternbloggern vernetzt. Auch bei Elternbloggern gibt es einige, die Kinder mit Behinderung haben. Und es gibt viele, die irgendwelche anderen Päckchen zu tragen haben. Also dieses Raus-aus-der-eigenen-Bubble, raus aus der Behinderten-Blase, sich vernetzen mit anderen, das finde ich super‑, superwichtig. Und ein Gespür dafür zu bekommen: was läuft bei Euch und zu sagen, guckt mal: bei uns läuft das und das falsch, wie seht denn Ihr das? Und dann festzustellen: die haben da auch Anknüpfungspunkte.
Denn wir Menschen mit Behinderung sind insgesamt doch zu wenige. Damit wir nicht als kleine Randgruppe wahrgenommen werden, können wir uns in Solidarität mit anderen verbinden. Das ist das, was ich super‑, supergut finde. Ich werde jetzt in den nächsten Wochen auch dabei sein, wenn der neue Familienbericht (der Bundesregierung) übergeben wird, als Vertreterin vom Verein von Eltern mit chronischen Krankheiten und Behinderungen (Bundesverband behinderter und chronisch kranken Eltern e.V.). Es ist der 9. Familienbericht und es ist das erste Mal, dass Eltern mit Behinderungen darin aufgeführt werden. Es tut sich was, aber leider noch zu langsam. Genau deswegen finde ich es wichtig, mit dabei zu sein und nicht nur zu meckern, so weit wie halt die Kraft reicht.
Eltern mit Behinderung und Eltern von Menschen mit Behinderung
Wow. Du hast eine Sache eher zwischen den Zeilen angesprochen: das manchmal nicht ganz einfache Verhältnis zwischen Menschen mit Behinderung und nicht-behinderten Eltern von Kindern mit Behinderung.
Ich erlebe das zum Beispiel oft, wenn ich bei Elternabenden bin, und Leute reden über ihre autistischen Kinder. Das ist sicher nicht böse gemeint, aber da fallen oft Äußerungen die ich als abwertend empfinde. Es geht vor allem darum, wie anstrengend die Kinder sind und wie „anders“ und oft wird dann auch mal gelacht, so „hahaha, die machen so komische Sachen“. Das geht mir dann zu weit und dann sage ich „äh, hallo, übrigens ich bin auch autistisch“ – und denke, sage aber nicht: „und die Hälfte von Euch auch, denn es vererbt sich bekanntlich meistens“. Andererseits gehören die Eltern trotzdem zu unseren größten potenziellen Verbündeten und haben teilweise auch Foren geschaffen, wo sich Menschen mit Behinderung austauschen können. Die Geschichte autistischer Selbstorganisationen hat auch angeregt durch und natürlich immer im Clinch mit Elternorganisationen angefangen. Das Verhältnis ist bis heute schwierig.
Du hast ja angesprochen, dass Du da auch Kontakte hast. Wie empfindest Du das Verhältnis?
Mir geht es teilweise ähnlich wie Dir. Ein kleines Beispiel: Ich wollte etwas auf dem Blog zum Welt-Down-Syndrom-Tag machen, aber eben mit Menschen, die die Fachkompetenz haben, weil sie davon betroffen sind. Eine Mama hat mich angeschrieben und gemeint, sie würde gerne was schreiben und ich meinte: „Naja, Dein Kind wäre doch jetzt eigentlich alt genug. Ich weiß, es ist auch im Internet unterwegs.“ Mich würde viel mehr interessieren: Was sagt das Kind, die Fachperson? Ich weiß, dass man als Eltern seinem Kind unheimlich nahe ist, und dennoch ist man nicht immer der richtige Ansprechpartner, denn man ist eben ein Vermittler. Man guckt sich das an und überlegt: Wie ist es jetzt für mein Kind?
Beim Verein von Eltern mit Behinderungen (Bundesverband behinderter und chronisch kranken Eltern e.V.) gibt es den Begriff des „Co-Handicaps“. Da geht es auch um den Partner, der ja auch mit in der Situation drin ist. Mein Partner kann aber nur sagen, wie es ihm mit mir als Frau und Mutter geht. Er kann nicht für mich sprechen. Manche Sachen sind für ihn super anstrengend und ich sage: „Nö, das ist doch kein Problem!“ oder genau andersrum. Und egal wie viel wir im Austausch sind: er ist nicht ich und sitzt nicht im Rollstuhl. Er hat eine Frau im Rollstuhl, ja. Das ist eigentlich seine Blase. Für den Blog suche ich auch Kinder, die Eltern mit Behinderung haben. Auch für mich als Mama ist das superspannend. Gerade bei meinem ersten Kind habe ich mich gefragt: wie erlebt er mich? Ich mach alles so gut wie es geht nach Kräften und nach bestem Gewissen, aber: wie ist es für ihn? Da kam in seinem Alter natürlich noch nicht so viel und ich weiß auch nicht, ob man seiner Mama oder seinem Papa direkt sagt: „Also das und das ist echt scheiße.“ Deshalb hab‘ ich jemanden gesucht, um in Austausch zu kommen: Wie war das für Dich als Kind, als Dein Papa im Rollstuhl saß? Und nicht mit dem Papa über die Kinder zu reden. Ich finde es wichtig, dass man sich da nicht als Stellvertreter sieht, sondern dass man sich bewusst über die eigene Position ist. Und pflegende Angehörige haben eine superschwere Position und was die leisten ist mega und unheimlich viel Arbeit und durchaus eine Belastung. Aber der eigentliche Ansprechpartner ist dann doch immer die betroffene Person.
…die es ja auch in der Regel noch schwerer hat. Angehörige mögen Schmerz mitfühlen oder ihren eigenen Schmerz haben, aber es gibt immer eine Person, der es noch schlechter geht: die Person mit Behinderung selbst.
Genau, richtig.
Widerstand beginnt damit, sich aus dem Haus zu trauen
Meine letzte Frage: Ich fand das schön wie Du zum Thema Aktivismus geschildert hast, wie Du Deine begrenzten Kräfte strategisch hier und da einsetzt. Das kommt mir bekannt vor. Seit ich vierzehn war bin ich auf Demos gegangen, aber dann gab es auch bei mir den Punkt mit Mitte 30 wo ich angefangen habe stressbedingt chronische körperliche Erkrankungen zu entwickeln und wo ich das dann nichtmehr konnte, auch aufgrund von sensorischen Sensibilitäten und allgemein reduzierter Energie. Und seitdem frage ich mich:
Was kann Aktivismus eigentlich sein jenseits von auf Demos gehen? Also bloggen ist eine Sache, aber was hättest Du sonst noch für Tipps für Leute die aktiv werden wollen aber denen die klassischen Formen von politischem Aktivismus nicht so liegen?
Super Frage! Ich glaube auch hier wieder Verbündete zu suchen, auch über Social Media. Es gibt so viele Dinge, die man teilen kann, einfach um darauf aufmerksam zu machen. Und dann in Verbindung zu kommen so gut es eben geht. Ich weiß, es ist schwer und kommt auch auf die Strukturen an, in denen man lebt. Hier auf dem Dorf bin hier tatsächlich der einzige Rollstuhlfahrer, den man sieht. Höchstens Sonntagmittags sieht man vielleicht noch ein paar ältere Menschen, die mit dem Rollstuhl geschoben werden. Hier Gleichgesinnte zu finden ist relativ schwierig. Ich kann mir aber vorstellen, dass das in anderen Umgebungen leichter oder schneller geht. Als ich das erste Mal in Berlin war, hat mein Kind zu mir gesagt, „Mama guck mal, die Leute gucken uns gar nicht an.“ Mir war das gar nicht so bewusst, aber er war damals vier und hat das wahrgenommen. Das wir da halt einfach so zwei von vielen waren. Was das ausmacht.
Und sich trauen. Das kann so vielfältig sein: es kann sein, dass ich mich traue andere anzusprechen, es kann sein, dass ich mich traue einen Aufruf über Social Media zu starten, es kann aber auch ganz einfach sein, dass ich mich traue vor die Tür zu gehen. Der allererste Schritt ist, dass ich diese Hemmschwelle abbaue und dass ich mir selber sage: es ist okay, und egal was die anderen sagen: ich bin da.
Ich weiß, dass das unheimlich schwer ist. Bei mir ging das oft erst dann, wenn der Leidensdruck zu hoch war. Meine Erkrankung verläuft schubförmig: zu Beginn konnte ich kleinschrittig laufen, dann bekam ich Unterarmgehstützen und irgendwann war klar, der nächste Schritt wird ein Rollstuhl sein. Doch erst als ich kaum mehr die Wohnung verließ habe ich mir überlegt: Ju, entweder das ist jetzt Dein weiteres Leben, oder Du lässt Dir helfen. Und dann kam der Rollstuhl, mein Hilfsmittel, und der hat mir geholfen, wieder rauszugehen.
Für mich war es in der Corona-Zeit sehr gut, dass es viele Online-Veranstaltungen gab, was für mich relativ barrierefrei war, wo ich schnell dazukommen konnte, so dass ich auch neue Leute wie Dich kennenlernen konnte und dadurch neue Verknüpfungen entstanden sind.
Ja, geht mir genauso. Was für ein schöner Schlussgedanke: einfach mal aus dem Haus gehen als Akt des Widerstands.
Ja! Viele Eltern mit Behinderung, auch mit Körperbehinderung, sind tatsächlich unsichtbar, weil man sie nicht sieht, nicht weil sie nicht da sind.
Das ändern wir jetzt. Danke für das wunderbare Gespräch!